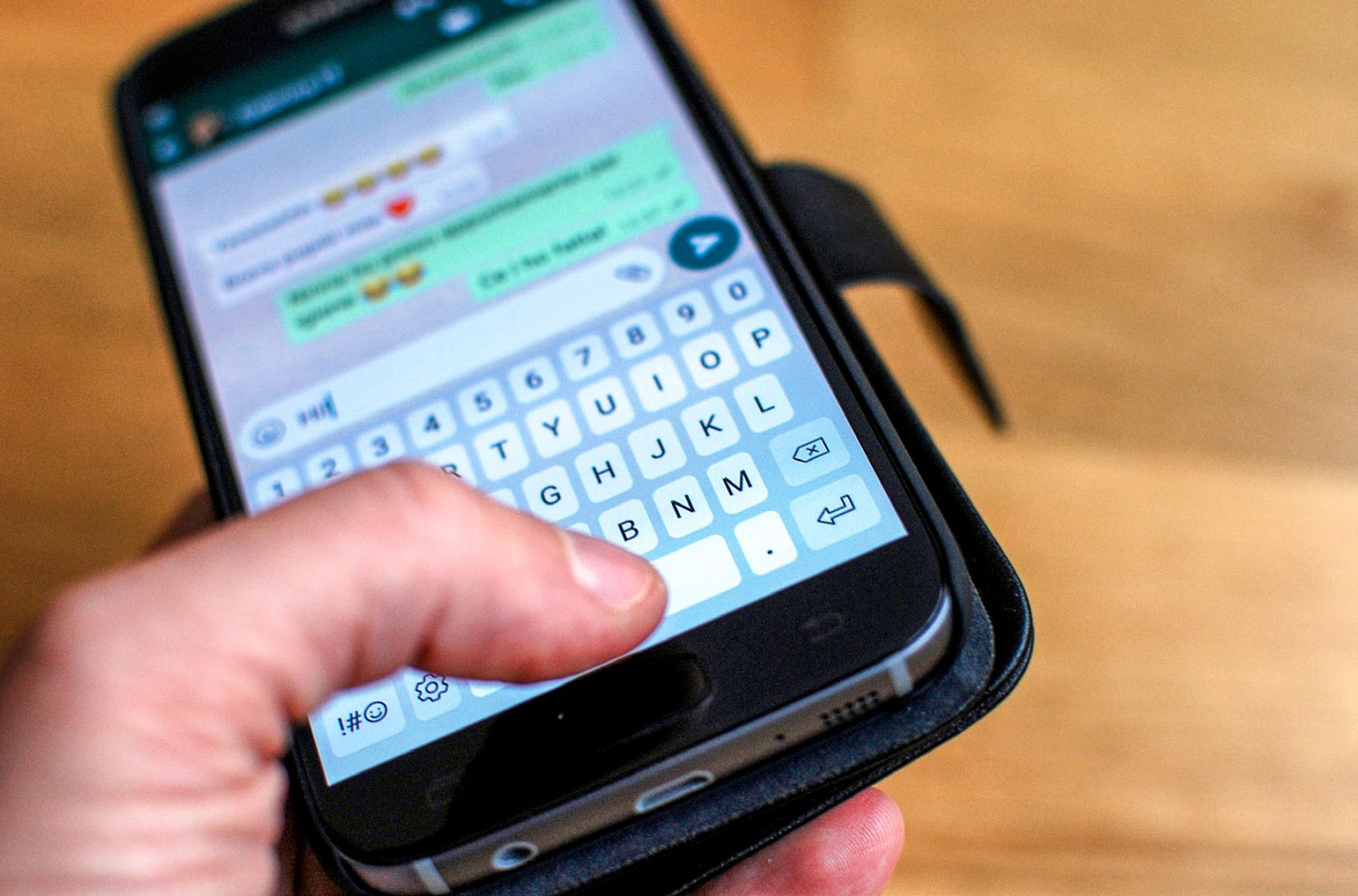Wie viel Privatsphäre darfs denn sein?
29.01.2021 GesellschaftFast jeder nutzt WhatsApp. Doch in den letzten Tagen ist der Messenger-Dienst ins Gerede gekommen – irgendetwas mit Datenschutz. Kritische Geister rufen dazu auf, andere Dienste zu nutzen. Ein Sturm im Wasserglas? Ja und nein.
MARK POLLMEIER
Ihren Anfang nahm die ...
Fast jeder nutzt WhatsApp. Doch in den letzten Tagen ist der Messenger-Dienst ins Gerede gekommen – irgendetwas mit Datenschutz. Kritische Geister rufen dazu auf, andere Dienste zu nutzen. Ein Sturm im Wasserglas? Ja und nein.
MARK POLLMEIER
Ihren Anfang nahm die Aufregung, wie so oft, in den sozialen Medien. Zu Beginn des Jahres äusserten sich erste Stimmen kritisch darüber, wie WhatsApp mit den gesammelten Daten umgehe. Von dort aus zog die Geschichte ihre Kreise, Nutzer begannen nachzufragen, die Presse berichtete. Was war geschehen?
Von den meisten noch unbemerkt, hatte WhatsApp seine Geschäftsbedingungen geändert. Unter anderem sollten künftig mehr Daten mit dem Mutterkonzern Facebook ausgetauscht werden. Verbunden waren die Änderungen mit einem Ultimatum: Wer WhatsApp weiterhin nutzen wollte, sollte den neuen Regeln bis 8. Februar zustimmen.
Nun ist es nichts Neues, dass Whats-App Daten sammelt. Schon bisher registrierte die App beispielsweise den Standort seiner Nutzer, wodurch sich mit der Zeit regelrechte Bewegungsprofile erstellen lassen. Nun könnten es eben noch ein paar Informationen mehr sein. Die Inhalte der Nachrichten sind verschlüsselt und insofern halbwegs sicher – über den Rest herrscht Unklarheit. Eines weiss man aber: Die Möglichkeit, die Weitergabe eigener Daten über die Einstellungen wenigstens teilweise zu unterbinden, soll künftig wegfallen.
Warum die Aufregung?
Der Widerstand gegen die angekündigten Änderungen und das mediale Echo waren überraschend gross. WhatsApp verlor binnen Tagen Millionen Mitglieder, Konkurrenten wie Threema oder Signal wurden als bessere Alternativen herumgereicht und von neuen Nutzern regelrecht überrannt. Neben den Kritikern gab es jedoch viele, denen die ganze Empörung übertrieben schien. Immerhin sollte WhatsApp ja weiterhin gratis sein. Warum also die Aufregung?
Richtig ist: Wer soziale Medien oder Messenger wie WhatsApp nutzt, muss in der Regel nicht die Kreditkarte zücken. Die grossen Tech-Konzerne verzichten darauf ganz bewusst. Rechnungen auszustellen würde den Angeboten die Leichtigkeit nehmen – und vor allem die begehrte Zielgruppe der Jüngeren abschrecken. Ihre Einnahmen holen sich Facebook und Co. woanders: von Werbeagenturen und Unternehmen. Für sie sind die Daten, welche die Nutzer freiwillig preisgeben, Gold wert.
17-jährige Schminkfans aus Zürich
Angenommen, ein Kosmetikhersteller will mit seinem Marketing 17-jährige Mädchen erreichen, die im Grossraum Zürich leben, sich gerne schminken, gleichzeitig aber ökobewusst sind und Tierversuche ablehnen. Kein Problem: Facebook weiss, wer die Gesuchten sind. Dafür müssen die jugendlichen Nutzerinnen sich gar nicht selbst als naturverbundene Kosmetikfans geoutet haben. Es reicht, dass sie an den richtigen Stellen den «Gefällt mir»-Button gedrückt oder etwas kommentiert haben. Den Rest erledigen Cookies, kleine Schnüffeldateien, die genau protokollieren, auf welchen Internetseiten sich jemand herumgetrieben hat und wie lange. Mit all diesen Informationen kann Facebook dem werbewilligen Kosmetikhersteller ein massgeschneidertes Angebot machen. Fortan wird die gebuchte Werbung bei genau der Zielgruppe eingeblendet, die der Auftraggeber sich gewünscht hat – der Traum jeder Marketingabteilung.
Doch Facebook hat ein Problem. Die 17-Jährigen aus dem Beispiel kommen dem Internetriesen mehr und mehr abhanden. Zwar tummeln sich weltweit 2,7 Milliarden Menschen regelmässig auf Facebook. Doch beim Nachwuchs hapert es; viele Jüngere haben inzwischen andere Plattformen für sich entdeckt.
Zuckerbergs Versprechen
Der Facebook-Führung ist das natürlich nicht entgangen. Schon frühzeitig ging der Konzern deswegen auf Shoppingtour. Alles, was irgendwie nach Social Media aussah und neue Nutzer versprach, wurde aufgekauft. Zu den spektakulärsten Übernahmen gehörte Instagram im Jahr 2012, das für 1 Milliarde Dollar geschluckt wurde. Und eben WhatsApp, das Facebook sich 19 Milliarden Dollar kosten liess. Ob der stolze Preis gerechtfertigt war, darüber lässt sich streiten. Strategisch betrachtet war die Übernahme jedoch sinnvoll. Mehr als zwei Milliarden Nutzer hat WhatsApp inzwischen weltweit. In der Schweiz ist der Messenger auf über 90 Prozent aller Smartphones installiert und so etwas wie der Standard, wenn es um unkomplizierte Kommunikation geht. Die Frage war nur, was Facebook mit dieser Marktführerschaft anstellen würde.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg gab sich zunächst leutselig. Gegenüber skeptischen Nutzern und WhatsApp-Angestellten beteuerte er nach der Übernahme, der Dienst bleibe unabhängig, die darüber versendeten Daten seien sicher. Auf Nachfrage der EU-Kommission gab Zuckerberg an, dass Nutzerprofile nicht abgeglichen werden sollten – und dass dies technisch auch nicht möglich sei.
Einführung verschoben
Tatsächlich ist WhatsApp bis heute ein eigenständiger Messenger – und weiterhin kostenlos. Branchenbeobachter waren jedoch seit der Übernahme überzeugt, dass das nicht so bleiben würde. Facebooks Geschäftsmodell beruht auf dem Sammeln und Nutzen von Daten. Insofern ist es nur folgerichtig, die Profile aus den rund 100 inzwischen aufgekauften Firmen zusammenzuführen. Und zu den wichtigsten gehört eben auch WhatsApp.
Wie die angekündigten Änderungen der Nutzungsbedingungen zu bewerten sind, muss jeder für sich selbst beantworten (siehe dazu auch Kommentar rechts). Fest steht: Wegen der anderen Rechtslage darf Facebook in der EU und der Schweiz weniger Daten sammeln als in den USA – jedenfalls offiziell. Ob sich der Konzern daran hält, ist zumindest fraglich. Die Beteuerungen Zuckerbergs haben sich schon öfter als unwahr herausgestellt – siehe oben.
Nach den Protesten gegen die Massnahme sind Facebook / WhatsApp zurückgerudert und haben die Einführung auf Mai verschoben. Bis dahin wolle man Aufklärungsarbeit betreiben, hiess es.
KOMMENTAR
Die Trägheit der Masse(n)
 «Ich habe nichts zu verbergen», heisst es oft, wenn die Datenschnüffelei der grossen Internetkonzerne zur Sprache kommt. Doch diese Einschätzung geht am Thema vorbei. Natürlich kann jeder für sich entscheiden, wie wichtig ihm die eigene Privatsphäre ist. Problematisch ist aber die Summe der (teils illegal) gesammelten Daten – eine unvorstellbare Menge an Informationen, konzentriert in der Hand weniger Konzerne, wie Google, Apple oder Facebook. Dass damit zielgruppengenaue Werbung möglich wird, ist noch das eine. Was aber, wenn die Datenmacht zur politischen Beeinflussung eingesetzt wird? Die Datenskandale der jüngeren Geschichte zeigen, dass dies zumindest versucht wurde. So ergaunerte sich eine Beratungsfirma die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern – und stellte sie 2016 dem Wahlkampf-Team des späteren US-Präsidenten Trump zur Verfügung. Ob Trump dadurch Vorteile hatte, lässt sich nicht abschliessend klären. Doch allein die Tatsache, dass ein solcher Vorgang möglich war, sollte alle Alarmglocken schrillen lassen.
«Ich habe nichts zu verbergen», heisst es oft, wenn die Datenschnüffelei der grossen Internetkonzerne zur Sprache kommt. Doch diese Einschätzung geht am Thema vorbei. Natürlich kann jeder für sich entscheiden, wie wichtig ihm die eigene Privatsphäre ist. Problematisch ist aber die Summe der (teils illegal) gesammelten Daten – eine unvorstellbare Menge an Informationen, konzentriert in der Hand weniger Konzerne, wie Google, Apple oder Facebook. Dass damit zielgruppengenaue Werbung möglich wird, ist noch das eine. Was aber, wenn die Datenmacht zur politischen Beeinflussung eingesetzt wird? Die Datenskandale der jüngeren Geschichte zeigen, dass dies zumindest versucht wurde. So ergaunerte sich eine Beratungsfirma die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern – und stellte sie 2016 dem Wahlkampf-Team des späteren US-Präsidenten Trump zur Verfügung. Ob Trump dadurch Vorteile hatte, lässt sich nicht abschliessend klären. Doch allein die Tatsache, dass ein solcher Vorgang möglich war, sollte alle Alarmglocken schrillen lassen.
Vor diesem Hintergrund ist die Aufregung um die Datennutzung bei Whats-App absolut gerechtfertigt. Gleichzeitig ist es illusorisch, in diesem Mini-Aufstand eine Trendwende zu sehen. Milliarden Menschen nutzen den Messenger aus dem Hause Facebook, zahllose Familien, Vereine und Firmen haben sich dort Chatgruppen eingerichtet. Dank dieser Vormachtstellung sitzt WhatsApp fest im Sattel – und wird es, trotz aller Kritik, auch weiterhin tun. Die Trägheit und Vergesslichkeit der Nutzer spielt Quasi-Monopolisten wie Facebook oder Google in die Hände. So bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Politik – auch zu ihrem eigenen Schutz – ein waches Auge auf die Datenkraken hat.
MARK POLLMEIER
M.POLLMEIER@FRUTIGLAENDER.CH