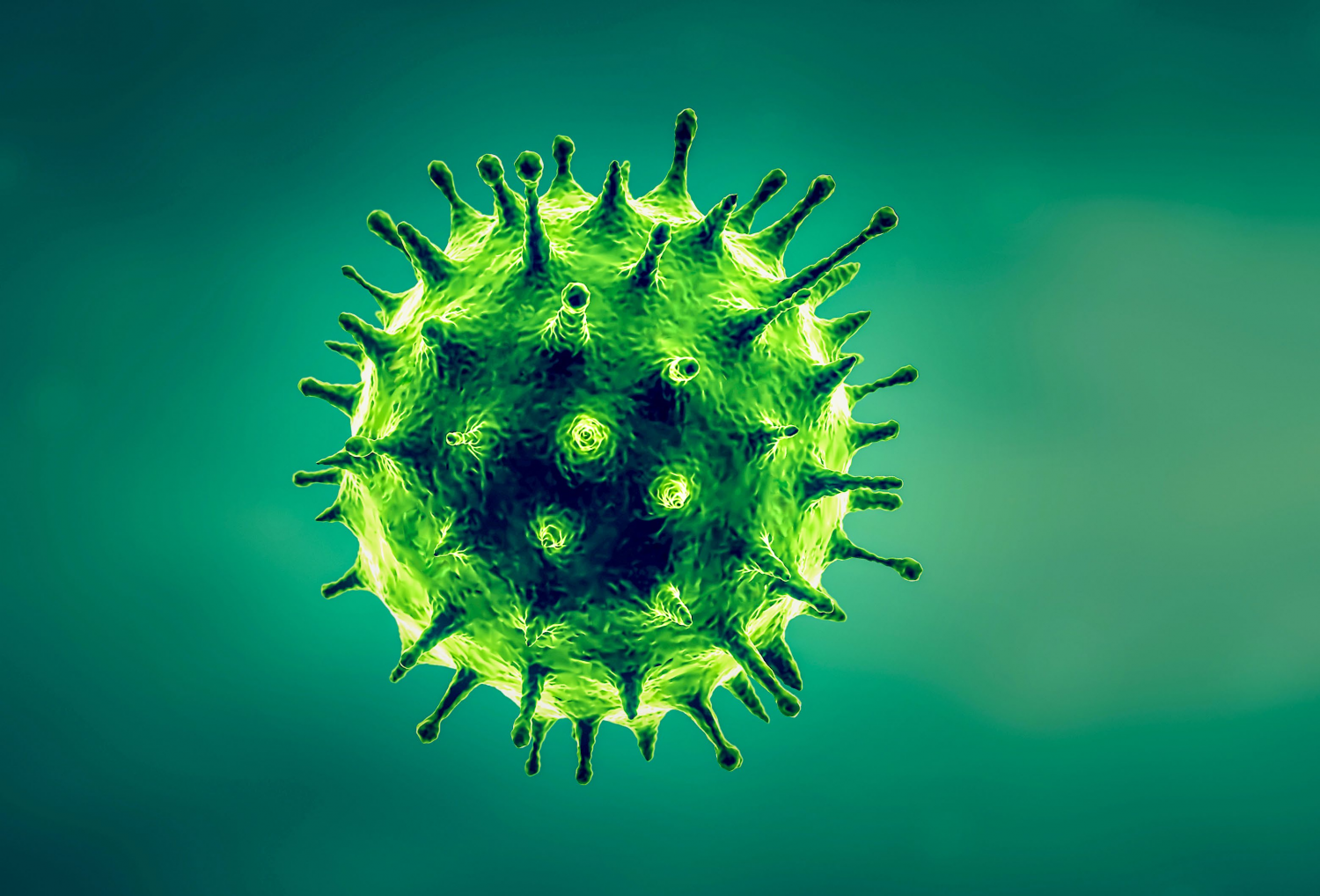Ein Jahr danach
26.02.2021 Coronavirus, RegionNormalerweise begeht man Jubiläen beschwingt. Anders verhält es sich in diesem Fall, denn im Mittelpunkt steht ein kleines Wesen, das auf der Welt seit gut einem Jahr grossen Schaden anrichtet. Am 25. Februar 2020 wurde das Coronavirus in der Schweiz erstmals ...
Normalerweise begeht man Jubiläen beschwingt. Anders verhält es sich in diesem Fall, denn im Mittelpunkt steht ein kleines Wesen, das auf der Welt seit gut einem Jahr grossen Schaden anrichtet. Am 25. Februar 2020 wurde das Coronavirus in der Schweiz erstmals nachgewiesen. Seither hält uns der Erreger in Atem, bestimmt unser Tun und unser Denken. Welche Folgen hatte die Pandemie, welche Erkenntnisse förderte die Krise zutage? Die «Frutigländer»-Redaktion liefert ein paar Beispiele.
Meine erste Lehre aus der Krise: Wir sind nicht unverwundbar. Auf der rationalen Ebene weiss ich das natürlich schon lange. Der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten, allenfalls abschwächen. Vor den Folgen für uns und vor allem unsere Mitmenschen auf der Südhalbkugel werden wir seit Jahrzehnten gewarnt. Auf der emotionalen Ebene war diese Verwundbarkeit bislang aber noch nicht so richtig angekommen. Kein Wunder: In den 1980er-Jahren in einem der reichsten Länder der Welt geboren, habe ich noch keine grosse Krise am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ob Bildungschancen, Reisefreiheit oder Wohlstand – es ging immer nur aufwärts. Doch als ich letzten April auf einer Anzeigetafel las: «Grenzen nach Deutschland geschlossen», war es endgültig aus mit jeder Unbekümmertheit. Plötzlich war nichts mehr selbstverständlich, nicht einmal ein Besuch bei meinen Eltern und Geschwistern im Nachbarland. Was mich direkt zu meiner zweiten Corona-Lehre führt: Statt die Welt zu bereisen, werde ich meine Ferien auch künftig vor allem bei der Familie verbringen. Ist ja auch besser fürs Klima.
BIANCA HÜSING
Das Coronavirus hat uns alle vermummt. Seit Monaten laufen wir in zahlreichen Situationen des Alltags mit einem Mund-Nasen-Schutz herum. In einem übertragenen Sinn gab es aber auch den gegenteiligen Effekt: Die Pandemie hat vieles demaskiert. Sie hat offenbart, wer in der Krise handlungsfähig bleibt und wer hoffnungslos versagt. Sie hat die Schwächen des Gesundheitswesens aufgezeigt und die Grenzen des Föderalismus. Das Virus hat verdeutlicht, welche Prioritäten die politischen Akteure des Landes setzen – und wie man Menschenleben beurteilt, wenn es ums Geld geht. Auch im Privaten fiel manche Maske, und was darunter zum Vorschein kam, war nicht immer schön. Dass die Nachbarin zu Verschwörungsblödsinn neigt, der Kollege die Wissenschaft verachtet und ein Freund alte Menschen für entbehrlich hält – auf solche Erkenntnisse hätte man gerne verzichtet. Sicher, es gab auch das Gegenteil: Menschen, die ganz neue Seiten von sich zeigten, die einen positiv überraschten. Doch nach einem Jahr überwiegt das Gefühl, dass man auf scheinbar solide Fassaden besser nicht allzu stark vertrauen sollte.
MARK POLLMEIER
Während des Shutdowns letzten Frühling plagte mich das schlechte Gewissen. Bisher hatte ich meine betagten Eltern regelmässig besucht. Nein, an den gedeckten Tisch setzte ich mich nie, sondern kochte zusammen mit Mutter für uns drei Mittagessen, erledigte den Abwasch, wechselte die Bettwäsche oder eine kaputte Glühbirne. Selten verliess ich ihre Wohnung ohne Auftrag oder Besorgung, die ich bis zu meinem nächsten Besuch zu erledigen hatte.
«Bleiben Sie zu Hause!», «Meiden Sie Kontakt (mit alten Menschen)!» Diese Aufrufe des Bundesrats haben sich in meinen Zellen eingenistet. Also leistete ich diesem Befehl folge und überliess das betagte Ehepaar seinem Schicksal.
Seit letztem Sommer erlaube ich mir, wieder hinzugehen. Nach Einführung der allgemeinen Maskenpflicht trage ich das Stück Stoff. Die «Umarmung auf Distanz» bei der Begrüssung und der Verabschiedung fällt so herzlich wie möglich aus, fühlt sich aber irgendwie falsch an!
Mit dem schlechten Gewissen habe ich wohl oder übel leben gelernt – und das bis zum bitteren oder glücklichen Ende.
KATHARINA WITTWER
77 Prozent der Stimmbevölkerung verwarfen vor fünf Jahren die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Leben abseits der traditionellen Arbeitswelt? Für viele war das offensichtlich unvorstellbar.
Seit einem Jahr beziehen nun zeitweise über eine Million Schweizer Arbeitnehmende eine Art bedingungsloses Grundeinkommen: Sie befinden sich in Kurzarbeit. Dieses wertvolle Instrument ist ein Privileg und führte dazu, dass im Januar 2021 «nur» 50 000 Personen mehr arbeitslos waren als kurz vor Ausbruch der Pandemie. Die meisten Kurzarbeitbetroffenen dürften sich auf den normalen Arbeitsalltag freuen. Viele von ihnen dürften aber ebenfalls realisiert haben, dass man sich in einer Gesellschaft auch ohne direkte Entlöhnung sinnvoll beschäftigen kann.
Krisen werfen eine Gesellschaft nicht nachhaltig aus der Bahn. Aber sie beschleunigen Veränderungen. Die nächste Abstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen kommt mit Sicherheit. Wie wird das Ergebnis wohl dann ausfallen?
JULIAN ZAHND
Bisher wurden ich und mein engeres Umfeld vom Coronavirus glücklicherweise verschont. Jammern ist also nicht angebracht, die Einschränkungen sind verkraftbar. Das zeigt mir, wie leidensfähig der Mensch ist. Was wir uns alles vorschreiben respektive vor allem verbieten lassen, um diesem unsichtbaren Mistkerl aus China die Überlebenschancen zu versauen, ist gewaltig. Sowas kennen wir höchstens aus irgendwelchen Psychothrillern. Aber wir können das! Desinfizieren, Masken, wenig Kontakte und Homeoffice gehören zum Alltag. Zuhause arbeiten war ja schon immer cool, ich nutzte und genoss jede sich bietende Gelegenheit dieser Ruhe. So effizient erledige ich die Arbeiten im Büro selten. Doch irgendwann ist es dann genug. Wie der unerschrockene Gallier Majestix fürchte ich nur eines: Dass mir mal der Himmel (oder zumindest die Decke) auf den Kopf fällt. Jetzt bin ich sogar froh, zweimal pro Woche das Redaktionsbüro zu hüten, auch wenn sonst niemand da ist. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal auf eine abendliche Gemeindeversammlung mit viel Volk freuen würde …
HANS RUDOLF SCHNEIDER