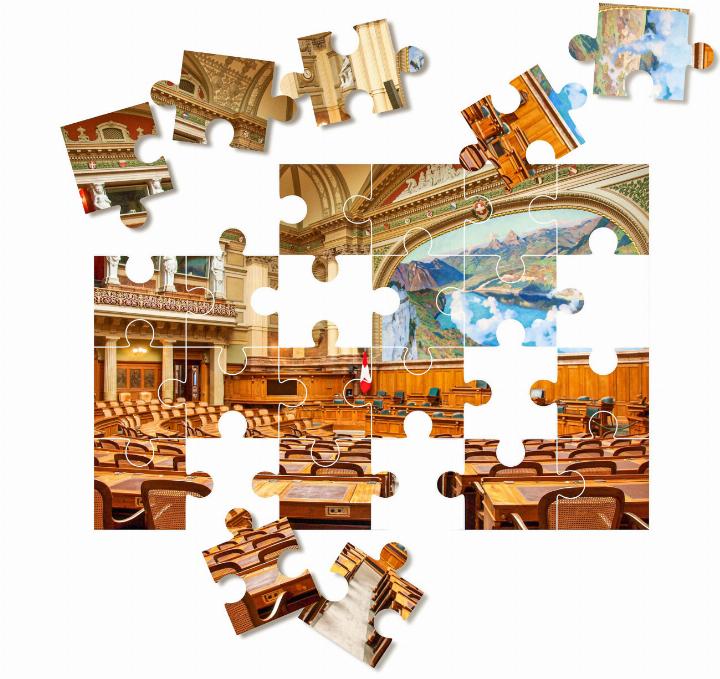Wofür stehen die Kandidierenden aus dem Frutigland?
19.09.2023 PolitikWie stark gehen die Parteien auf die Sorgen der BürgerInnen ein? Um diese Frage zu klären, konsultierten wir die aktuellen Sorgenbarometer von SRF, Tamedia und Moneyland und entnahmen daraus die fünf am häufigsten erwähnten Herausforderungen des Landes. Es sind ...
Wie stark gehen die Parteien auf die Sorgen der BürgerInnen ein? Um diese Frage zu klären, konsultierten wir die aktuellen Sorgenbarometer von SRF, Tamedia und Moneyland und entnahmen daraus die fünf am häufigsten erwähnten Herausforderungen des Landes. Es sind dies die Gesundheitskosten, die Energieversorgung, die Zuwanderung, der Klimawandel und die Altersvorsorge. Anhand dieser fünf Themen wurde der Auftritt der Parteien analysiert. Welche dieser Schwerpunkte spielen im gegenwärtigen Wahlkampf eine Rolle? Pro Partei verliehen wir insgesamt 5 Punkte. Sie sagen nichts aus über die Qualität der Argumente, sondern beschreiben lediglich, wie stark die Partei das jeweilige Thema gewichtet. Ein Wert von 5 würde bedeuten, dass eine Partei ausschliesslich auf einen Themenbereich setzt. Würde sich die Partei allen fünf Themen in ähnlichem Masse widmen, erhielte sie pro Schwerpunkt je einen Punkt. Im ersten von insgesamt vier Teilen widmen wir uns der bürgerlichen Listenverbindung, bestehend aus SVP und FDP.
Wählbar sind im Frutigland alle Kandidierenden aus dem Kanton Bern. Weil eine individuelle Vorstellungsrunde bei 776 Kandidierenden den Rahmen sprengen würde, beschränken wir uns auf die BewerberInnen aus dem Frutigland. Sie erhielten von uns die Möglichkeit, sich anhand von zwei Fragen kurz zu präsentieren.
JULIAN ZAHND
Zwischen Pop und Krieg
SVP Das Volk, lateinisch populus. Es darf somit niemanden überraschen, dass die Schweizerische Volkspartei im Wahlkampf teils tief in die Werkzeugkiste der populären Methodik greift. Den Wahlauftakt beging die SVP in der Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten vor 4000 ZuschauerInnen, eine solche Mobilisierung anlässlich von Wahlen hat die Schweiz zuvor noch nicht erlebt. Es war dann auch alles andere als eine ordentliche Parteiveranstaltung, die am 26. August über die Bühne ging – es war ein Event. Hinter den Mikrofonen standen keine Politiker, sondern Stars. In den Rängen sass nicht die Parteibasis, da sassen Fans. Und der Anlass an sich? Der wurde zur politischen Show.
Wer selbstbewusst ist, und die prognostizierte Wahlsiegerin hat allen Grund dazu, der kann sich auch Selbstironie leisten. In ihrem Parteisong inszenierte sich die SVP als lässige Truppe, die sich und die Politik nicht allzu ernst nimmt. Das wirkte irgendwie sympathisch und nahbar – und sollte wohl insbesondere jene Bevölkerungsgruppen ansprechen, denen die Politik grundsätzlich zu kompliziert, zu elitär, zu langweilig ist.
Plötzlich ist der Spass vorbei
Jenseits dieses unverkrampften Auftritts zeigt sich jedoch schnell: Der Partei ist es ernst, sehr ernst. Die Rhetorik ist martialischer denn je: Der Wahlkampf wird auch mal als «Schlacht» bezeichnet, die Partei sieht sich im «Krieg», um den «Frontalangriff» auf die Identität des Landes abzuwehren. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass diese Kriegserklärung von einem Teil der Bevölkerung gut aufgenommen wird. Gegenwärtige Prognosen rechnen mit einem Wählerzuwachs von rund zwei Prozentpunkten – mehr als bei allen anderen Parteien.
Im letzten Jahr noch präsentierte sich die politische Grosswetterlage anders. Die Volkspartei hatte Mühe, sich mit ihren Kernthemen in Szene zu setzen, ihre Anti-Woke-Kampagne fand in der Bevölkerung nicht die gewünschte Resonanz. Durch den Krieg in der Ukraine, die drohende Energieknappheit und die steigenden Preise wuchs in der Bevölkerung jedoch die Unsicherheit – und damit eine Stimmung, die die Partei seit jeher gut zu nutzen weiss. Denn wer unzufrieden ist und um seine Zukunft bangt, der findet bei der SVP einfache Antworten.
Und er findet Schuldige, denn bevor die Partei eigene Lösungen präsentiert, prangert sie an, verurteilt, warnt. Im Fokus steht dabei – wenig überraschend – vor allem ein Thema, das nach Ansicht der Partei alle anderen politischen Bereiche beeinflusst.
Zuwanderung – 4 Punkte
Den mit Abstand grössten Schwerpunkt legt die Partei auf die Aussen- und Ausländerpolitik sowie auf die Migration. Eines der Kernstücke auf der politischen Agenda ist die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz», für die zurzeit die Unterschriftensammlung läuft. Sie zielt nicht auf Geflüchtete, sondern auf die ständige ausländische Wohnbevölkerung (mit einer Bewilligung für mindestens 12 Monate), die für die wachsende Einwohnerzahl der Schweiz hauptverantwortlich ist. Aktuell zählt die Schweiz knapp 9 Millionen EinwohnerInnen, Tendenz steigend. Bis ins Jahr 2050 soll diese Zahl gemäss Initiative nicht weiter als bis zur 10-Millionen-Marke anwachsen. Das im Initiativtitel enthaltene Versprechen wäre damit zwar nicht eingehalten, doch einem weiteren Bevölkerungswachstum wäre bei einer Annahme zumindest vorläufig der Riegel geschoben.
In ihrer Argumentation stützt sich die SVP auf das Zahlenmaterial des Bundesamtes für Statistik, legt dieses aber ziemlich eigenwillig aus. So wird etwa die (korrekte) Zahl der Einwanderungen von gut 180000 Personen im Jahr 2022 genannt. Nicht erwähnt werden hingegen die rund 120000 Personen, die im gleichen Zeitraum das Land verlassen haben. Auch die von der Partei verfasste Grafik zu den Einbürgerungen vermittelt auf den ersten Blick ein falsches Bild: Da die Kurve von Jahr zu Jahr steigt, könnte man interpretieren, dass sich auch die Zahl der Einbürgerungen jährlich erhöht, was aber nicht der Fall ist. Die Zahl bewegt sich seit Jahren auf einem relativ stabilen Niveau von 40000. Die steigende Kurve entsteht, weil die SVP die Einbürgerungen der Vergangenheit einfach aufsummiert.
Energieversorgung – 1 Punkt
Die Energiestrategie bezeichnet die Partei als «verlogen», «unrealistisch» und «risikoreich». Die SVP bekämpft diese langfristige Strategie denn auch konsequent. Eine sichere Stromversorgung erachtet die SVP als wichtig, die beiden zentralen Pfeiler dafür seien die Wasserkraft und die Kernenergie. Die neuen Erneuerbaren wie etwa Sonnen- oder Windenergie könnten dann ausgebaut werden, wenn dies ökonomisch sinnvoll sei und der Versorgungssicherheit diene.
Gesundheitskosten – 0 Punkte
Die derzeitigen Preisschübe werden im aktuellen «Extrablatt» der Partei nur am Rande erwähnt, im Wahlkampf sind sie kein Schwerpunktthema. Zwar fordert die SVP mehr Eigenverantwortung, mehr Wettbewerb und weniger Bürokratie. Doch vor allem kritisiert sie die Migration, die für den Kostenanstieg hauptverantwortlich sei.
Altersvorsorge – 0 Punkte
Im aktuellen Wahlkampf der SVP kommt das Thema kaum vor. Die SVP anerkennt die AHV als wichtige Institution, die es zu stärken gelte. Konkrete Vorschläge, wie dies zu erreichen sei, bleiben aber aus.
Klimawandel – 0 Punkte
Der Begriff taucht bei der SVP selten auf, die Partei sieht zumindest in der Schweiz keinen dringenden Handlungsbedarf. Im Visier sind hingegen die Klima-Kleber, welche mit ihren «schikanösen Handlungen» erheblichen Schaden anrichten würden. Im Gegenzug bricht die Partei eine Lanze für den Individualverkehr.
Smart und geschliffen
FDP Der Freisinn hat in der Schweiz keinen leichten Stand: In den letzten 100 Jahren schwand sein politischer Einfluss kontinuierlich. Seit der Jahrtausendwende liegt der Wähleranteil unter 20 Prozent, gegenwärtig sind es rund 15 Prozent. Die Partei lässt nichts unversucht, um diesen Trend zu stoppen. Unter dem Präsidium von Petra Gössi schlug die FDP einen neuen Klimakurs ein – was teilweise selbst die eigene Wählerschaft erstaunte. Seit der Wahl Thierry Burkarts im Jahr 2021 ist die Partei wieder etwas nach rechts und dadurch an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Der Umweltschutz rückte in den Hintergrund, Schwerpunktthemen sind eine liberale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik mit möglichst wenig Staatseinfluss. Insbesondere in der Aussenpolitik unterscheidet sich die FDP von der SVP, mit der sie für die bevorstehende Wahl wieder mehr Listenverbindungen eingegangen ist: Während sich die SVP vom Ausland möglichst isolieren will, plädiert der Freisinn für eine offene Aussenpolitik.
Um das eigene Profil zu schärfen, grenzt sich die FDP nach allen Seiten ab: Sie kritisiert die «grüne Verbotskultur» ebenso wie die «rechtskonservative Abschottung» und den «konservativen Stillstand». Speziell zu letzterem setzt die FDP einen Kontrapunkt. Sie präsentiert sich als dynamische, pragmatische Partei, die Hand bieten will für konsensfähige Lösungen. Wie glaubwürdig dieser smarte, geradezu keimfreie Auftritt ist, muss sich zeigen. Nach anfänglich vielversprechenden Prognosen geht man Stand heute von leichten Verlusten aus, die Partei könnte sogar von der «Mitte» überholt werden. Gut möglich, dass der Negativtrend durch den Niedergang der Credit Suisse befeuert wurde, den FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter managen musste. Eine solche Niederlage gegen die Konkurrenz in der Mitte würde sich unter Umständen auch auf die Sitzverteilung im Bundesrat auswirken. Nach der angestammten Zauberformel haben nur die drei wählerstärksten Parteien einen Anspruch auf zwei Sitze. Während die SVP und die SP gesetzt sind, kämpfen FDP und Mitte noch um Position drei.
Gesundheitskosten – 2 Punkte
Die Partei bewirtschaftet dieses Themenfeld prominent. Die Lösungsansätze sind breit gestreut. Die FDP fordert etwa eine Umstrukturierung der Spitallandschaft, mehr Spezialisierung, mehr Wettbewerb und Transparenz bei der Kostenabrechnung. Sie will Parallelimporte für Medikamente erleichtern und appelliert an die Eigenverantwortung der Patienten. Schliesslich verlangt die FDP eine Flexibilisierung der Versicherungsmodelle und bringt einen konkreten Vorschlag ins Spiel – eine Budget-Krankenkasse mit höherer Franchise und abgespecktem Leistungsumfang. Die Idee stiess jedoch bei anderen Parteien auf Kritik.
Energieversorgung – 1 Punkt
Die FDP erachtet die Dekarbonisierung als sinnvoll, da sie die Unabhängigkeit des Landes stärke. Den Prozess will sie aber nicht durch staatliche Eingriffe wie Verbote, sondern durch Innovation und Preisanreize ankurbeln. Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 bezeichnet die Partei als gescheitert. Kurzfristig will man die Integration in den europäischen Strommarkt auch nach 2025 sichern, den Strommarkt vollständig liberalisieren und den Ausbau erneuerbarer Energie beschleunigen. Die Kernenergie lehnt die Partei nicht ab. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sei man auch künftig auf Grosskraftwerke (Gas oder Atom) angewiesen, wobei Kernkraft aufgrund der Klimaziele vorzuziehen sei.
Altersvorsorge – 1 Punkt
Bei der Altersvorsorge herrscht Reformbedarf, davon ist die FDP überzeugt. Anpassungen regt sie bei allen drei Säulen an: Die AHV soll existenzsichernd bleiben, deshalb befürwortet die Partei eine Erhöhung des Rentenalters. Die Jungfreisinnigen haben eine Initiative lanciert, die eine schrittweise Anhebung fordert, die an die Lebenserwartung gekoppelt ist. Gemäss Schätzungen würde das Rentenalter bis 2032 auf 66 Jahre, bis 2050 auf etwas über 67 Jahre ansteigen – also um jeweils einen bis zwei Monate pro Jahr.
Weiter will die FDP die zweite Säule modernisieren und für Personen mit tiefen Einkommen und Teilzeitpensen öffnen. Durch «bessere Anreize für mehr Eigenverantwortung» soll zudem die private Vorsorge attraktiver werden.
Klimawandel – 1 Punkt
Ihrer Grundhaltung entsprechend setzt die FDP weder auf Protestaktionen noch auf Regulierungen, um den Klimawandel zu bekämpfen. In einer «Neuauflage des CO2-Gesetzes» präsentiert die Partei ein Drei-Säulen-Modell (Gebäude – Mobilität – Industrie) mit verschiedenen Massnahmen, damit die Klimaziele erreicht werden können. Dabei gehen die Freisinnigen erstaunlich weit: Mittelfristig bringen sie sogar nationale Grenzwerte ins Spiel, sollten die zuvor getroffenen Massnahmen nicht ausreichen, um die Ziele zu erreichen.
Zuwanderung – 0 Punkte
Zwar ist die FDP für ihre restriktive Haltung in der Migrationspolitik bekannt. Thematisiert wird dieser Bereich im Wahlkampf aber kaum. Womöglich überlässt die Partei dieses Feld bewusst ihrer Listenpartnerin, der SVP.