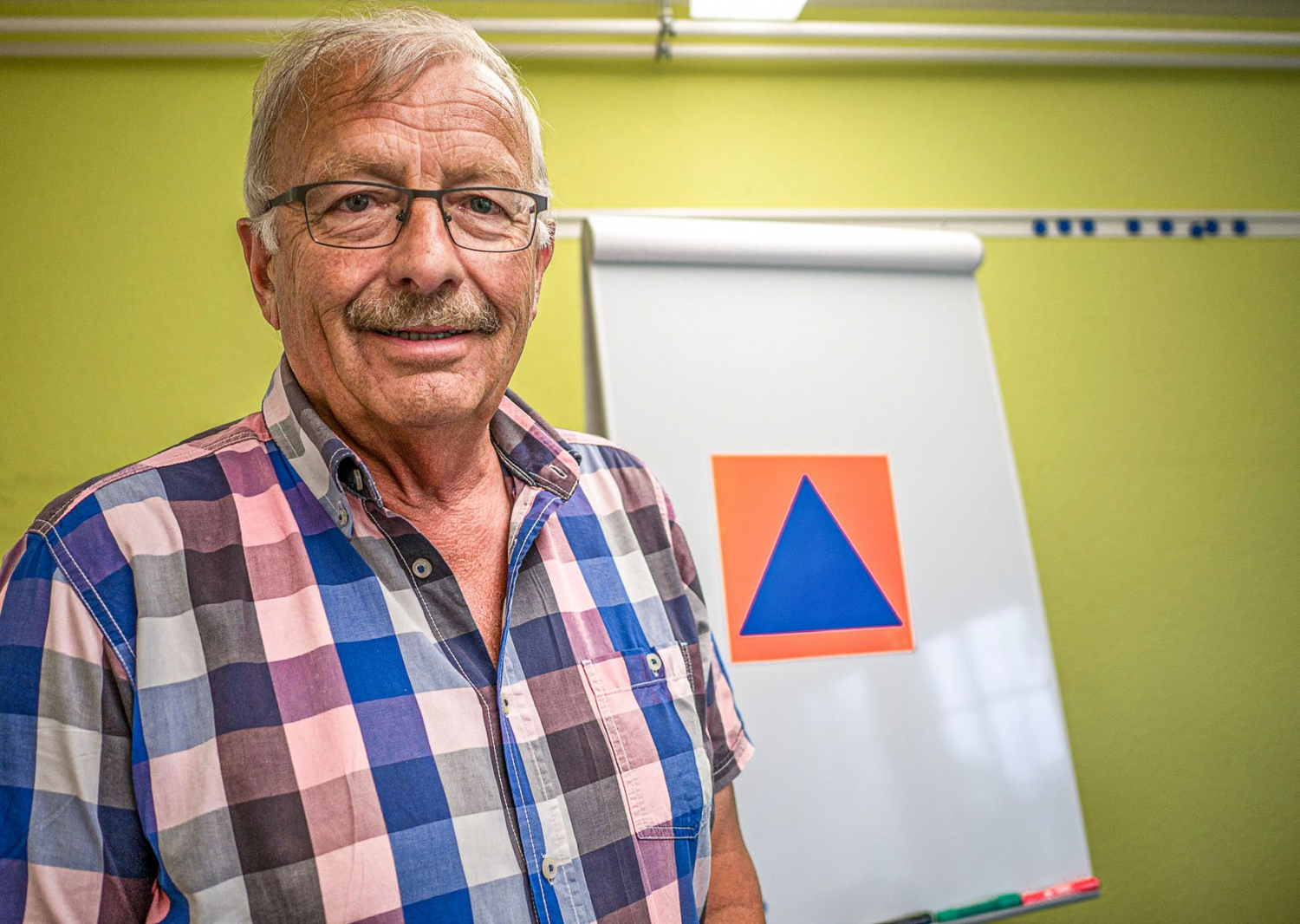«Helfen ist doch schön»
05.05.2020 Frutigen, GesellschaftEr war mitten drin, als es losging mit der Corona-Krise, jetzt ist er ganz draussen: Peter Rösti, Kommandant der kantonalen Zivilschutzkompanie und verantwortlich für Grossanlässe, ist pensioniert. Ein Blick auf eine oft kritisierte Organisation – und auf deren ...
Er war mitten drin, als es losging mit der Corona-Krise, jetzt ist er ganz draussen: Peter Rösti, Kommandant der kantonalen Zivilschutzkompanie und verantwortlich für Grossanlässe, ist pensioniert. Ein Blick auf eine oft kritisierte Organisation – und auf deren Image.
HANS RUDOLF SCHNEIDER
Auswirkungen von Stürmen, Lawinen und Hochwassern hat er zu bewältigen geholfen, aber auch bei eidgenössischen Schwingfesten oder dem Adelbodner Ski-Weltcup war er gern gesehen. 30 Jahre lang hat der Kandergrunder Peter Rösti sich für die Öffentlichkeit engagiert, sei das im Nebenamt als Gemeindepräsident oder beruflich als Zivilschützer.
Angefangen hatte er 1990 beim heutigen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär. Der Orkan Vivian war gerade durch das Land gebraust und hatte verheerende Schäden hinterlassen. Für Rösti war dies der Augenblick, um seinen damaligen Arbeitgeber, die «Aeschikasse» zu verlassen.
Im Ernstfall immer vor Ort
«Ich wollte helfen.» So einfach beschreibt er seine Motivation. Wie hilfreich Unterstützung sein kann, hat er als Gemeindepräsident von Kandergrund selber erfahren, nachdem der Orkan Lothar das Oberland verwüstet hatte. Das seien Augenblicke, die man nicht vergisst. Vielfach müsse man dann vor Ort auch einfach zuhören, das helfe bereits. «Die realen kleinen Probleme der Einzelnen muss man ernst nehmen, auch wenn das grosse Ganze vom Bürotisch aus oft anders aussieht.» Und Rösti war zweifelsohne ein Mann, der im Ernstfall vor Ort war und zuhören konnte. Das wird von Zivilschützern aller Stufen betont.
Vertrauen als Voraussetzung
Hilfe bedeutet aber auch, dass Reserven und eine funktionierende Organisation vorhanden sein müssen. Rösti half mit, den Zivilschutz im Kanton Bern zu professionalisieren. Aus einst 400 grossen, kleinen und kleinsten Organisationen wurden knapp 30. Und der nächste Konzentrationsschritt ist bereits absehbar. Die Dauer der Einteilung von Zivilschutzangehörigen wird von aktuell 20 auf 12 Jahre reduziert. «Ich schätze, es wird nach 2021 im Kanton Bern noch 15 bis 18 Formationen geben. Die regionale Zusammenarbeit wird dadurch noch wichtiger, und wenn nötig, müssen Zivilschützer noch mehr über Kantonsgrenzen hinweg eingesetzt werden», schaut Peter Rösti in die Zukunft. Das funktioniere aber nur, wenn man sich persönlich kenne und unkompliziert Hilfe erbeten könne. «Einmal helfen wir den anderen, dann sie uns. Das gibt Kitt und Vertrauen untereinander.»
Neue Aufgaben als Partner
Der Gründungsgedanke, die Zivilbevölkerung bei kriegerischen Auseinandersetzungen zu schützen, ist in den Hintergrund gerückt. Auch die Kontrolle muffiger Zivilschutzkeller oder das Zusammennageln von Holzbetten für die Schutzräume ist Geschichte. Heute ist die Organisation viel stärker als Dienst für die breite Öffentlichkeit zu sehen. Gerade bei den Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Sanität seien rasch oder über längere Zeit einsetzbare Leute gefragt. «Und zwar als gleichwertige Partner», betont Peter Rösti.
Sobald beispielsweise ein Ersteinsatz der Feuerwehr beendet ist, müssen diese Kräfte abgelöst werden. Das sei die Stärke des Zivilschutzes neben der durchwegs hohen Motivation. Wenn die Arbeit sinnvoll sei, werde nicht daran gezweifelt, und die Leistungsbereitschaft sei hoch. Das bringt Peter Rösti aber auch zum Nachdenken: «Die Armee rekrutiert als Erste. Nur wer nicht tauglich für Militär- und Zivildienst ist, kommt für den Zivilschutz in Frage. Vielleicht sollten wir über eine allgemeine Dienstpflicht nachdenken – egal in welcher Organisation und natürlich auch für Frauen.» Entscheiden müsse darüber die Politik.
Risiko nicht vergessen
Die Politik bestimmt auch, ob der Ski-Weltcup Adelboden weiterhin mit 4500 Manntagen unterstützt wird, ebenso wie die Skirennen in Wengen oder grosse Schwingfeste. Als ehemals Verantwortlicher für Grossanlässe zieht Rösti diese Arbeiten nicht in Zweifel, immer vorausgesetzt, die Politik stützt diese. Er sieht darin eine wichtige Ausbildung für die Kader, die grössere Kontingente organisieren und befehligen lernen müssen. Auch wenn seit dem Hochwasser 2005 kein grossflächiges Ereignis mehr eingetreten sei, müsse man bereit sein. «Es besteht die Gefahr, dass nachfolgende Generationen das Risiko kleiner einschätzen – bis wieder etwas passiert.»
So ist er auch der Ansicht, dass die Unterstützungseinsätze aufgrund der Corona-Krise insbesondere den Stäben auf Kantons- und Bundesebene viele neue Erfahrungen gebracht hätten. Bei den ersten Planungen war Rösti noch selber dabei, nun kann er mit der Distanz des Pensionierten zuschauen. Persönlich verzichtet er wegen der Verbote und Empfehlungen der Behörden derzeit auf die Reise in die Wohnung im geliebten Tessin, ansonsten ist er viel im Garten. «Zum Glück bin ich gesundheitlich zwäg.»
«Immer auf Pikett zu sein, belastet schon»
Er hat auch nichts dagegen, die Verantwortung jetzt nicht mehr tragen zu müssen. Immerhin hatte er gut 250 Mann unter sich, die beispielsweise die Stäbe der Regierungsstatthalter unterstützen können. So müssen die lokalen Organisationen nicht Leute delegieren, die dann anderswo fehlen. Peter Rösti erzählt mit Begeisterung von seiner Arbeit. Aber: «Faktisch immer auf Pikett zu sein, belastet schon. Und wenn es dann richtig losging, war ich meist die ganze Zeit mittendrin.»
Er beschreibt leise, wie er nach schweren Naturereignissen Wertsacheninventare von Lawinen- oder Hochwasseropfern protokollieren musste. Sein Blick schweift dabei kurz in die Ferne. Und dann folgt, nicht zum ersten Mal im Gespräch: «Wer aber in einer Notlage helfen kann, ist immer auf der guten Seite – helfen ist doch schön.»
ZUR PERSON
Der Kandergrunder Peter Rösti (Jahrgang 1955) machte eine kaufmännische Lehre und arbeitete bei der 1992 mit der «Frutigkasse» fusionierten «Aeschikasse». Seit 1990 ist er beim kantonalen Zivilschutz, wo er 2006 das Kommando über die kantonale Formation übernahm. Verantwortlich zeichnete er auch für die Einsätze der Zivilschutzangehörigen an Grossanlässen. Von 1991 bis 2000 war er in Kandergrund Gemeindepräsident. Zudem engagierte er sich im Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Frutigland. Nach 16 Jahren in diesem Gremium trat er 2019 als deren Präsident zurück.
HSF