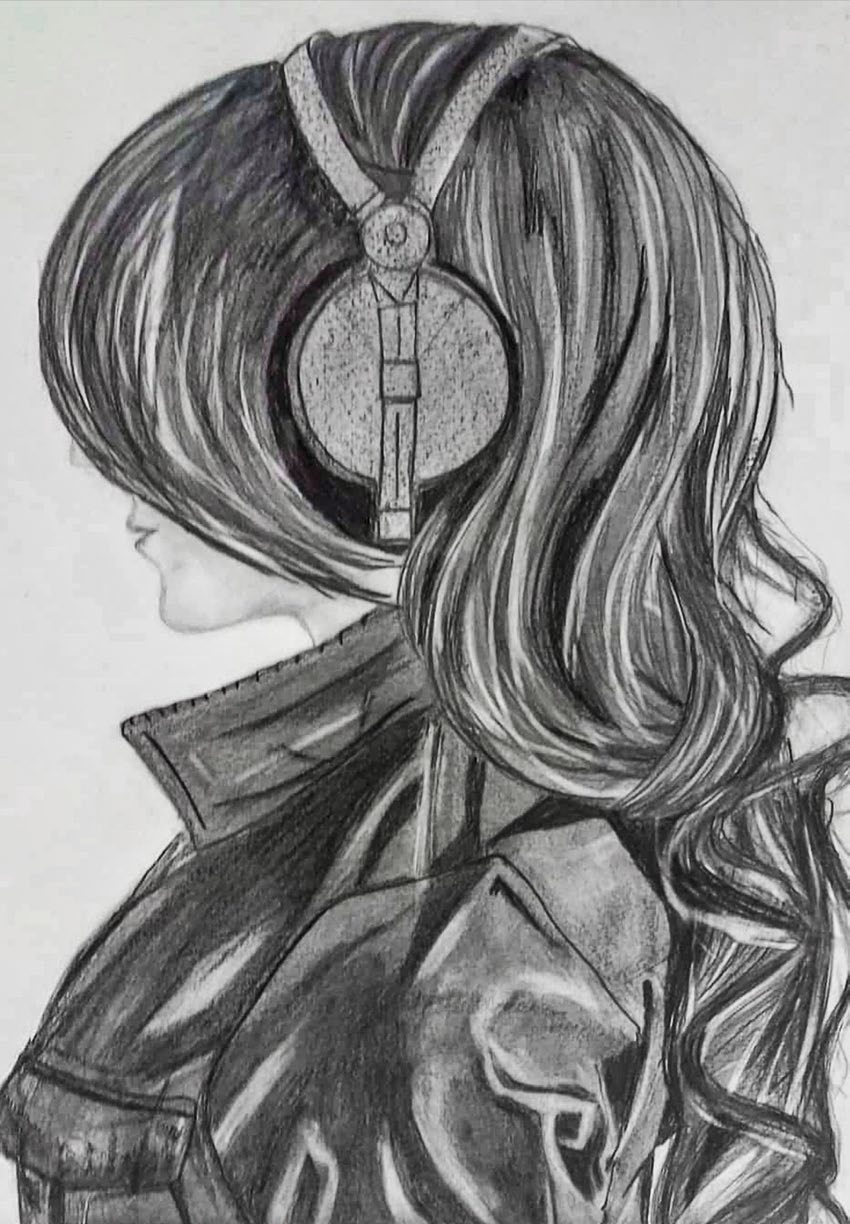«Ich mache das, worin ich gut bin!»
05.05.2020 Frutigen, Wirtschaft, GesellschaftOb in kleinen Wohnungen oder grossen Geschäftsgebäuden: Samira Nejadi hat stets den Überblick und bestimmt, wo und wie der Strom verlaufen soll. Seit einem knappen Jahr wird sie zur Elektroplanerin ausgebildet – für die geflüchtete Afghanin eine hart erkämpfte ...
Ob in kleinen Wohnungen oder grossen Geschäftsgebäuden: Samira Nejadi hat stets den Überblick und bestimmt, wo und wie der Strom verlaufen soll. Seit einem knappen Jahr wird sie zur Elektroplanerin ausgebildet – für die geflüchtete Afghanin eine hart erkämpfte Perspektive.
BIANCA HÜSING
Samira Nejadis Wünsche sind bescheiden. Gern würde die 22-Jährige mit ihrer Familie in eine grössere Wohnung ziehen – am liebsten nach Thun. Weil sie in Frutigen arbeitet und in Bern die Berufsschule besucht, wäre die Lage der Stadt ideal. Ausserdem träumt sie davon, endlich einmal Frankreich zu sehen. Davon hält sie zurzeit nicht nur die Corona-Krise ab, sondern auch ihr Aufenthaltsstatus. Als vorläufig aufgenommene Ausländerin mit F-Ausweis darf sie nicht frei reisen. Doch bald schon könnte ihr Wunsch in Erfüllung gehen: «Wenn ich mein erstes Lehrjahr abgeschlossen habe, darf ich einen B-Ausweis beantragen», verkündet sie strahlend.
Zeichnen, rechnen, planen – genau das Richtige für die 22-Jährige
Seit letztem August lässt sich Samira Nejadi bei elektroplan Buchs & Grossen zur Elektroplanerin EFZ ausbilden. Was sie dort berechnet und entwirft, setzen Elektroinstallateure später in die Tat um. «Ich lege fest, wo die Leitungen verlaufen sollen, wie dick die Rohre sein müssen und an welchen Stellen Lichtschalter und Notleuchten angebracht werden», umschreibt sie ihren täglichen Job. Auch Überwachungskameras und Telefonanschlüsse fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Ob in kleinen Wohnungen oder grossen Firmen: Nejadi hat stets die Übersicht und ermittelt, wie der Strom am effizientesten verteilt werden kann. Ein Blick auf die kleinteiligen Pläne auf ihrem Computerbildschirm dürfte bei Laien Schwindel auslösen. «Es braucht schon viele Details», räumt sie lachend ein.
Für Samira Nejadi scheint der Beruf wie gemacht. Ursprünglich wollte sie zwar Architektin werden, hat in dem Bereich allerdings keinen Ausbildungsplatz gefunden. «Viele Betriebe hatten ein Problem mit meinem Kopftuch», glaubt sie. Nach einer Reihe vergeblicher Bewerbungen riet Nejadis Lehrer ihr dazu, sich nach artverwandten Berufen umzuschauen – zum Beispiel dem eines Elektroplaners. «Das hat mich sofort interessiert, da ich gern zeichne und auch ein gutes Verständnis für Elektrotechnik habe.» In ihrer Heimat habe sie oft alte Geräte repariert.
Eine diskriminierte Minderheit im Iran
Geboren und aufgewachsen ist Nejadi im Iran. Wie ihr Vater ist sie jedoch afghanischer Nationalität, was das Leben im Iran nicht unbedingt einfacher macht. Wurden sie dort in den 1970er-Jahren noch mit offenen Armen empfangen, werden afghanische Minderheiten heute diskriminiert und unterdrückt. Auch Samira Nejadi hat dies so empfunden. «Afghanen müssen viel Geld für Bildung zahlen und werden für die gleiche Arbeit viel schlechter bezahlt als Iraner.» In einzelne Städte dürften Afghanen gar nicht mehr einreisen, Gewalt sei ebenfalls keine Seltenheit. Das Hauptproblem verortet die 22-Jährige jedoch nicht in der iranischen Bevölkerung, sondern in der Regierung, die beide Gruppen gegeneinander ausspiele.
Zur Schule ging Nejadi acht Jahre lang. Nebenbei half sie immer ihrem Vater aus, einem Schneider. Wie viele Gleichaltrige träumte sie von einer guten Ausbildung und einer besseren Zukunft. «Was für Afghanen im Iran eine unrealistische Hoffnung war, ist für die meisten Menschen in der Schweiz selbstverständlich», so Nejadi.
«Unser Weg war sehr lang und voller Schwierigkeiten»
Um der Diskriminierung und der Perspektivlosigkeit zu entkommen, floh die Familie in Richtung Europa. «Unser Weg war sehr lang und voller Schwierigkeiten», erinnert sich Samira Nejadi. Bereits an der Türkisch-iranischen Grenze verloren die Geschwister ihren Vater, den sie erst in der Schweiz wiedersehen sollten. Unzählige Kilometer legten sie zu Fuss zurück, warteten an Grenzen und erlebten Nächte, in denen sie vor Kälte kein Auge zutaten. «Ausruhen konnten wir uns nur, wenn wir in den Zug stiegen.» Zwischendurch musste der herzkranke Cousin ins Spital. Doch nebst all den Beschwerlichkeiten erlebten Nejadi und ihre Familie auch Lichtblicke: Immer wieder trafen sie auf Menschen, die ihnen mit Wasser, Essen und Zugtickets halfen. «Dafür bin ich sehr dankbar.»
Homeschooling: eine sprachliche Herausforderung
Als sie vor viereinhalb Jahren in der Schweiz ankamen, waren Samira Nejadi und ihre Geschwister monatelang krank – so sehr hatte ihnen die Flucht zugesetzt. Ihr Vater erreichte das ersehnte Ziel erst zwei Jahre später. Nach Stationen in Kreuzlingen, Heimberg und Zweisimmen wohnt Nejadi heute mit ihrem 20-jährigen Bruder, ihrer 18-jährigen Schwester und ihrem Vater in Interlaken. Ihre dritte Schwester lebt mit ihrem Ehemann und ihrem Kind in der Türkei. In ihrer Interlakner Wohnung verbringt die Auszubildende aufgrund der Corona-Krise gerade mehr Zeit, als ihr lieb ist. «Ich will wieder zur Schule gehen!» Dort wurden ihr die Aufgaben immer gut erklärt, zu Hause muss sie überwiegend selbstständig arbeiten – was vor allem sprachlich eine Herausforderung darstellt. Auch ist es für sie ohne Kontakte schwieriger, ihr Deutsch zu verbessern. Immerhin: Samstags findet per Videochat ein Sprachkurs statt. Ausserdem nutzt Nejadi die Zeit, sich ihrer grossen Leidenschaft zu widmen: dem Zeichnen.
Lieber Zahlen als Worte
Mit der Sprache ist es ohnehin so eine Sache. Samira Nejadi kann besser mit Zahlen und Plänen umgehen als mit komplizierten Ausdrücken. «Das ging mir im Iran mit Persisch auch schon immer so», lacht die 22-Jährige. Was sie deshalb regelrecht auf die Palme bringt, ist die immer wieder gestellte Frage, warum sie einen Männerberuf ausübe. «Es gibt keine Frauen- oder Männerberufe. Ich mache das, worin ich gut bin!»
Dass sie gut ist, bestätigt auch ihr Arbeitgeber. «Samira ist sehr talentiert, intelligent und hat eine gute Auffassungsgabe. Auf komplexen Plänen findet sie sich mühelos zurecht», meint elektroplan-Co-Geschäftsleiter Jürg Grossen. Das Einzige, woran es noch ein wenig hapere, sei eben die Sprache. Doch auch in dieser Hinsicht mache sie Fortschritte. «Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, ‹Frutigdütsch› mit ihr zu reden», so Grossen. «Das muss sie schliesslich früher oder später auch können.»
Ein Beitrag gegen den Fachkräftemangel
Nebst Nejadis Begabungen und ihrer Motivation ist es aus Grossens Sicht auch ihr kultureller Hintergrund, der den Betrieb bereichert. «Wo verschiedenste Menschen aufeinandertreffen, geht es oft interessanter und sogar lustiger zu.» Von der ausländerkritischen Haltung vieler Oberländer, die in Abstimmungen zum Ausdruck käme, spüre Grossen im Alltag überhaupt nichts. «Bei der persönlichen Begegnung bricht das Eis, und Vorurteile werden abgebaut.» Trotzdem habe er ein gewisses Verständnis gegenüber der Skepsis vieler Betriebe, Geflüchtete auszubilden. Je nach Herkunftsland bestehe schliesslich die Gefahr, dass die Lehrlinge mitten in der Ausbildung ausgeschafft werden. «Bei Samira droht uns das zum Glück nicht.»
Der glp-Nationalrat arbeitet zurzeit an einem Vorstoss, der die Perspektiven für gut integrierte Geflüchtete – und damit auch für deren Arbeitgeber – verbessern soll. «Es fehlen schliesslich Zehntausende Fachkräfte in den technischen Berufen.»
Samira Nejadi könnte in etwas mehr als drei Jahren eine dieser begehrten Fachkräfte sein – und überdies eine der wenigen Frauen in ihrem Beruf. Bis dahin wird sie vermutlich auch in einer grösseren Wohnung leben und Frankreich bereist haben. Doch ihr allergrösster Wunsch ist schon jetzt zum Greifen nahe: «Ich möchte in der Schweiz bleiben. Ich liebe dieses Land.»